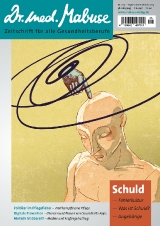"Zuschauen, aushalten und nicht urteilen". Als Ärztin in Papua-Neuguinea
Von: Silke Bertram. In: Dr. Mabuse, Nr. 205, Sept./Okt. 2013
Vier Jahre arbeitete unsere Autorin als Ärztin und Entwicklungshelferin auf einer kleinen Insel Papua-Neuguineas. Dort lernte sie eine fremde Kultur kennen, die ihre westlichen Vorstellungen und Gewohnheiten radikal erschütterten. Zwei Schlagzeilen, die kürzlich in Deutschland über Papua-Neuguinea durch die Presse gingen, waren die einer Tochter, die ihrem Vater nach einer Vergewaltigung den Kopf abschlug und die einer Meute, die aus den Gehirnen und Penissen der von ihnen getöteten Medizinmänner Suppe kochte – reißerische Geschichten, die unsere Vorstellungen einer archaischen Kultur bedienen.
>>> mehr zu Dr.med.Mabuse - Zeitschriften
Im Jahr 2001 machte ich mich als Ärztin mit meinem Mann und den damals drei kleinen Kindern, auf den Weg nach Papua-Neuguinea. Frank, mein Mann – von Beruf Architekt – und ich teilten uns für vier Jahre je eine halbe Stelle.Frank sollte das Krankenhaus, das in den 1960er Jahren gebaut worden war, renovieren und der stark wachsenden Bevölkerung anpassen, nebenbei noch der Hausmeister der Anlage sein sowie unsere Kinder per Fernschule unterrichten.
Ich sollte den ausländischen Arzt – der zusammen mit einem einheimischen Arzt das 180-Betten-Kreiskrankenhaus leitete – ersetzen, was bedeutete für alle Kranken, egal welcher Fachrichtung, da zu sein.
Ein bunte Welt
Unsere Reise ging nach Karkar, eine aktive Vulkaninsel mitten im Pazifik und 14.000 Kilometer von Deutschland entfernt. Fährt man einmal um die Insel herum, hat man nur 80 Kilometer mehr auf dem Tacho und ist vorbeigefahren an Kokosnuss-, Kakaoplantagen und Regenwald, an glasklarem Meer mit unglaublichen Riffen, an schwarzem Sand, vorbei an Buschhütten mit vielen Kindern – begleitet von winkenden Händen und fröhlichen Zurufen, von Papageien - gekreische und Flughundgeflatter. Am Ende der Um rundung ist man satt, hat sich den Bauch vollgeschlagen mit Schönheit und Lachen.
Schreckensmeldungen zur Begrüßung
Im Gepäck hatten wir viel Enthusiasmus, mehr Neugier als Idealismus und als blinde Passagiere:
hinderliche Vorurteile und bestimmt auch unschuldige Überheblichkeit. Als wir in diesem verflucht schönen Land ankamen, prasselten genau solche Ereignisse wie eingangs in den Schlagzeilen beschrieben auf uns ein.
Einem einheimischen Arzt lief ein Kind ins Auto. Als er sich beugte, um Erste Hilfe zu leisten, wurde ihm vom Vater des Kindes der Kopf abgeschlagen. Ein Krankenhausbus mit Schwestern wurde
auf dem Nachhauseweg überfallen und alle Frauen vergewaltigt. In den ersten Tagen auf Karkar wurde ich in die Leichenhalle zu zwei Zwanzigjährigen gerufen, die dort mit durchschnittenen Kehlen lagen, weil sie angeblich ein Dorfoberhaupt verzaubert“ hatten. Diese Dinge passierten in unserer direkten Nachbarschaft, rückten bis auf einen Atemhauch an uns heran.
Papua-Neuguinea war von mehrfacher Kolonialisierung und Missionierung überrollt und entwurzelt worden, ohne Zeit, um Luft zu holen und die Scherben einzusammeln. So zerriss das starke soziale Netz. Die Dörfer wurden für die inzwischen gut ausgebildete Jugend zu eng, die Städte boten keine Arbeit – eine explosive Mischung. So mehrten sich ne ben den Stammeskämpfen Überfälle, häusliche Gewalt und Vergewaltigungen.
Wir waren hin- und hergerissen zwischen der Freundlichkeit der Menschen, der Wärme, die sie uns entgegenbrachten, und der rohen täglichen Gewalt. Es dauerte keine drei Tage und wir fragten uns, was wir hier eigentlich machten und das noch mit drei Kindern. Wo ist das nächste Flugzeug zurück in meine Sicherheit und Vertrautheit, fragte ich mich. Diese rasante Berg- und Talfahrt setzte sich fort. Mich beflügelte, dass ich nichts weiter zu tun hatte, als mich um die PatientInnen zu kümmern – in einem Krankenhaus ohne Computer, mit viel terminfreier Zeit. Hier änderten sich die Prioritäten blitzartig und ich war dankbar, mich besinnen zu dürfen, was „leben und leben lassen“ heißt.
Mal keine Medikamente zu haben, keine Hygienevorschriften, ein Labor, über das deutsche KollegInnen lachen würden, nur acht Stunden Strom am Tag, Würmer im Mehl und Spinnen, die einem im OP über die nackten Füße huschen – alles kein Thema. Verblüffend schnell fielen diese Schwierigkeiten von uns ab, wie eine zu eng gebundene Krawatte, die man endlich lösen kann. Eine gute Erfahrung.
Mehr als nur medizinische Herausforderungen
Auf der anderen Seite war ich bestürzt:
nicht nur über das, was sich Menschen gegenseitig antun können. Es waren etwa Situationen, wie vor einem Jungen zu stehen, dem eine herunterfallende Kokosnuss
den Schädel zertrümmert hatte. Vielleicht kam man noch auf das Wort für die operative Öffnung des Schädels – Trepanation, um schnell im Buch nachzuschlagen, was zu tun war – und dann
fluchte man, weil das letzte Fläschchen Ketamin zur Betäubung fast leer war und die Sauerstoffflasche schon seit letzter Woche. Man fluchte weiter, weil kein erfahrener Kollege da war, der so etwas schon mal gemacht hatte und einem das Zittern aus den Händen klopfen konnte. Oder weil kein Angehöriger zum Blutspenden taugte und keiner wusste, was zu tun war, als dem Jungen letztlich das Herz stehen blieb. In rasantem Tempo kam bei mir nach den ersten Wochen im Land alles ins Rutschen. Ehe ich mich umsah, war ich mit meinem bisschen Erfahrung in der
Gynäkologie oft alleine als Ärztin – in einem wenig funktionierenden System, umgeben von einer ebenso schönen wie brutalen, giftigen, Menschen verschlingenden Natur, konfrontiert mit Schadens - zaubern, Piratenüberfällen, Stammeskämpfen, Menschen, die Geister sehen und auch noch mit ihnen reden, in einem anderen Lebens-, Krankheits- und Sterbeverständnis. Konfrontiert mit einer Kultur, die so anders ist, dass ich unentwegt in Fettnäpfchen trat, merkte ich immer mehr, dass ich diesen Menschen nicht gerecht werden konnte, weil ich sie nicht verstand.
Erschütterungen und Perspektivwechsel
Das wachsende Bewusstsein, dass wir, die als Entwicklungshelfer geschickten Weißen, uns hier als die mit zwei linken Händen entpuppten, die ohne Geld in der Tasche verhungern würden und das Leben nicht verstanden, erschütterte mich, ließ mich aufseufzen, wie ein angepiekster Luftballon. Wie nutzlos und sogar schädlich unsere westlichen Strategien, mit denen wir zu helfen versuchten, hier waren, führte uns auch ein schwerer Überfall vor Augen. Dabei wurden auch meine Eltern, die gerade zu Besuch waren, verletzt und ausgeraubt. Dies änderte unseren Blickwinkel endgültig. Mit staunenden Augen nahm ich Menschen wahr, die völlig autark ihr Leben meisterten. Menschen, die alles herstellen können, was sie zum Leben brauchen, die ihr eigenes Rechtssystem haben, die ein noch komplexeres Denken haben als wir, weil sie andere Dimensionen mit einbeziehen und mit anderen Welten vertraut sind.
Es war erstaunlich, wie man sich täuschen konnte. Zuerst dachte ich, wie arm die Menschen hier sind, durchlöcherte T-Shirts, keine Schuhe, eine Baumschlinge als Gürtel. Und nach einem Monat sahen wir alle so aus, zogen noch nicht mal mehr für einen Ausflug in die Stadt Schuhe an und fingen an, darüber zu philosophieren, was Armut eigentlich ist. Wenn ich fragte, wer sich arm fühle, war die Antwort ein dröhnendes Lachen: „Wir sind frei, wer kann sich das schon kaufen?“ Die einzige Frage, die wir uns daraufhin stellen konnten, war: Was sollen wir hier eigentlich?
Absturz nach dem Honeymoon
Schon in der Vorbereitungszeit waren wir darüber aufgeklärt worden: Nach dem „Honeymoon“ mit dem neuen Land folgte der große Absturz. Die Zeit, in der man realisierte, dass nichts funktionierte, die Uhren anders tickten, man den im Vertrag stehenden so wichtigen Auftrag vielleicht nicht umsetzen konnte oder das initiierte Projekt nicht nachhaltig sein würde. Es fiel schwer, dies zu akzeptieren, über den eigenen Schatten zu springen und sich selbst nicht mehr für so wichtig zu halten. Es war die Zeit, in der wir deutscher wurden als je zuvor oder das Gegenteil versuchten, nämlich alles Deutsche abzulegen, um einen Weg aus dem Frust zu finden. Wir wussten auch, dass derjenige, der es aus diesem Tal nicht wieder herausschafft, Gefahr läuft, Rassist oder Alkoholiker zu werden. Denn wer fast jeden Tag toten Kindern die Augen zudrücken musste – in dem Bewusstsein, sie noch hätte retten zu können, wären die Eltern früher ins Krankenhaus gekommen – gerät schnell an seine Grenzen. Der Gründer der Klinik, ein Australier, hatte dies nicht mehr ausgehalten, am Ende die Eltern beschimpft und geschlagen. Er hatte nicht mehr die Distanz, um zu sehen, dass die Eltern sich selbstverständlich vorbildlich gekümmert, ihre Kinder sofort zu einem Medizinmann gebracht hatten und sich mit dem Dorf zusammensetzten, um mögliche krankheitsauslösende Konflik te aufzudecken und zu lösen. Er konnte nicht akzeptieren, dass auch dies grundsätzlich richtig sein konnte. Aber was braucht ein Mensch in seinem Gepäck, um diese Phase zu überstehen, um sich und den Menschen des Gastlandes gerecht zu werden? Wie viel Toleranz, Wertefreiheit, Reflexionskompetenz und Empathiefähigkeit sind notwendig? Wie viel von der eigenen Kultur darf und muss man sich erhalten, um nicht in die Assimilationsfalle zu laufen?
Neuanfang und Sinneswandel
Unwissend wie Kinder ließen wir uns daraufhin an die Hand nehmen. Wir lernten, Betelnüsse zu kauen, die richtigen Fragen zu stellen, wir lernten, im Jetzt zu leben. Wir nahmen die irklichkeiten der Menschen in ihrem Land als unsere an, um nicht mehr aneinander vorbei zu reden. Ich ließ mich auf einen therapeutischen Synkretismus ein, um PatientInnen wirklich gerecht zu werden und die Chance auf Heilung zu vergrößern. Wir lernten Gelassenheit, und den Humor nicht zu verlieren. Unser Ziel war es nicht mehr, etwas zu bewegen, sondern zusammenzuleben und voneinander zu lernen. Dafür mussten wir auch lernen, im richtigen Moment und mit vollem Respekt loszulassen – und uns darauf besinnen, nur Gast zu sein. Das beinhaltete zuzuschauen, auszuhalten und nicht zu urteilen. So etwa bei einer Mutter, die in der Klinik ihr sechstes Kind tot gebar. Als ich sie fragte, ob sie nicht sterilisiert werden wolle – ich sollte der Überbevölkerung entgegenwirken – druckste sie rum. Ich fragte, wie viele ihrer Kinder überhaupt noch lebten. Sie antwortete: „Keines.“ Die Bettnachbarin erzählte dann, dass der Onkel die Frau verflucht hätte, weil sie einen Mann geheiratet hatte, den er nicht akzeptierte. Für ihren Ungehorsam sollte jedes Kind von ihr sterben. Auf meine Frage, ob der Clan sich nicht zusammensetzen könnte, um den Fluch aufzuheben, schüttelte sie nur traurig den Kopf. Auch die Frage, ob sie an eine höhere Macht als die der Zauberer glaube, verneinte sie. Ich konnte nichts für sie tun.
Unerwartete Lehrmeister
Auch unter den vielen Freunden unserer Kinder fanden wir einige unserer größten Lehrmeister. Durch ihre Unvoreingenommenheit und die uns entgeentgegengebrachte Liebe öffneten sie unsere Herzen. So wurden ihre Geschichten zu unseren und ihre Wirklichkeiten normal. Durch sie schaffte ich es, nicht mehr überheblich zu schmunzeln, wenn die Mutter eines an Tuberkulose erkrankten Kindes, das seit Tagen schrie, mich bat, mit ihr in das Dorf zurückzukehren, um die vergessene Seele des Kindes abzuholen. Mit der Zeit wusste ich, dass dieses Kind friedlich sein würde, wenn es aus dem Dorf zurückkehren würde. Ich lernte die Macht der Schadenszauber kennen und dass die Botschaften der Geister und Träume häufig stimmten.
Es dauerte zwei Jahre, bis wir das Gefühl hatten, richtig angekommen zu sein. Erst dann konnten wir produktiv arbeiten, bevor schon der Abschied begann. Es dauerte so lange, um zu begreifen, dass dieses Land in den letzten fünfzig Jahren eine Entwicklung hat durchmachen müssen, für die andere Länder Jahrhunderte Zeit hatten. Plötzlich war unsere Zeit schon um.
Der Abschied war für alle schmerzhaft. Und doch landeten wir erleichtert, alles heil überlebt zu haben, im winterlichen Deutschland, um sofort schockzugefrieren.
Fühlt es sich so an, wenn man seine Seele an einem anderen Ort vergisst? ■
Zum Weiterlesen:
Silke Bertram: Im Puls Papuas. Wo ich meine Seele vergaß. Sidihoni-Verlag, Rottenburg 2012, 300 S., 25 Euro. Bestellung unter www.sidihoni.com
Silke Bertram, geb. 1966, ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe.
>>>direkt zu Mabuse Verlag: Zeitschriften